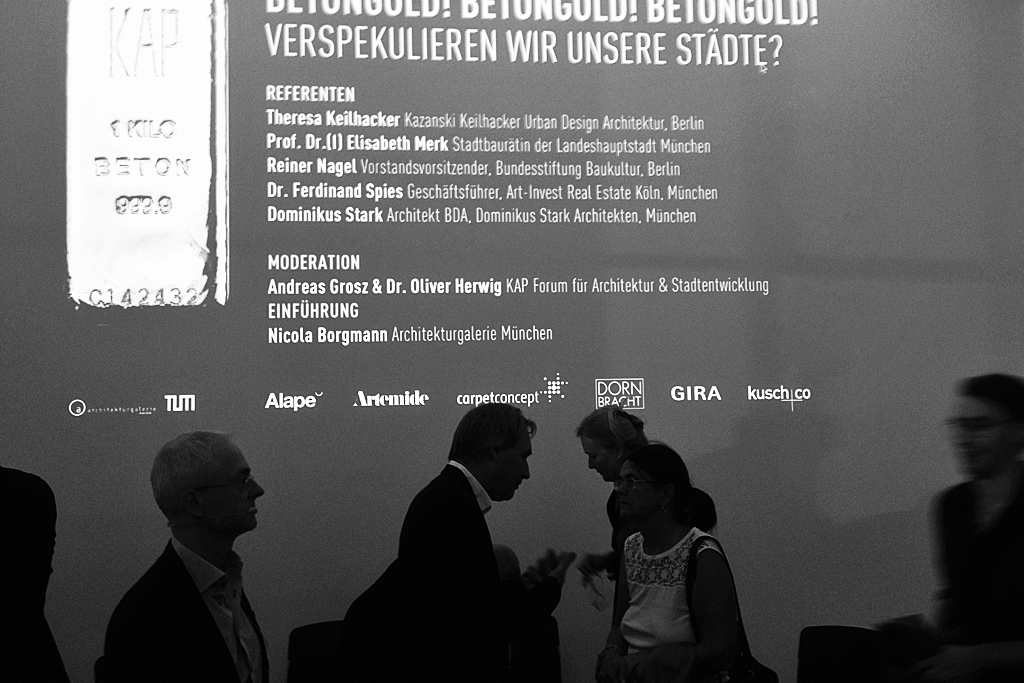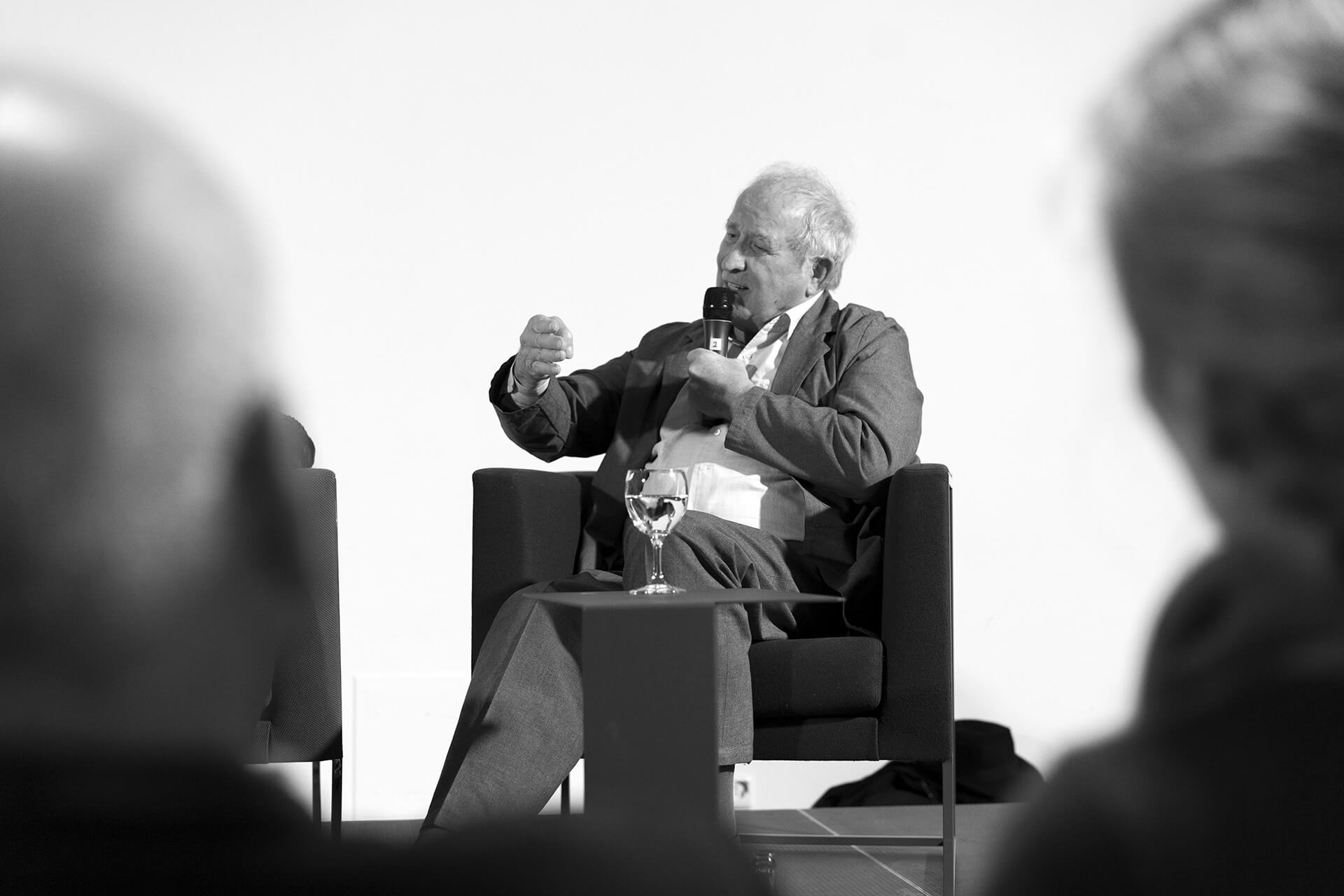Nachlese
Mehr Experiment wagen
KAP Forum: Reihe Vordenker
Nathalie de Vries begeistert im Kölner MAKK mit hybridem Denken.

Der frisch renovierte Vortragssaal des Kölner MAKK platzte aus allen Nähten. Rund 250 Gäste verfolgten den Vortrag von Nathalie de Vries im Rahmen der Reihe VORDENKER des KAP Forums. Unter dem Titel „Hybrid/Experiments“ zeigte die Mitgründerin von MVRDV, welches Potential in multifunktionellen Häusern und Planungen steckt.
„Ist die Stadt ein Labor?“, fragte die Architektin rhetorisch – und gab gleich die Antwort: „Stadträume müssen sich verdichten, optimieren, vermischen. Wir wollen eine bessere, lebenswertere Stadt.“ Das war zugleich eine Absage an Adenauers Wahlkampfslogan der Fünfziger Jahre – keine Experimente. Denn es ist schon erstaunlich, dass die scheidende Professorin an der Kunsthochschule Düsseldorf (sie wechselt nach Delft) hierzulande keine Beispiele für hybride und multifunktionelle Gebäude finden konnte – auch nicht ihre Studierenden.



Dafür legte Nathalie de Vries lieber selbst los und gab einen einstündigen Themenvortrag zur Bedeutung von Hybriden in ihrem eigenen Werk. Doch was ist das überhaupt – ein Hybrid? Es geht um ein neues, vernetztes Denken, konzeptionell und frei von Barrieren. Da könne ein dritter Raum entstehen, privat gebaut und doch ganz öffentlich, ein Haus, so offen angelegt für verschiedenste Nutzer mit ganz unterschiedlichen Wünschen. Das klang ein wenig nach postmoderner Theorie, wie sie etwa auch Wolfgang Welsch vertreten hat in seinen „Perspektiven für das Design der Zukunft“ von 1990: „Die klassisch-modernen Maximen des Ausdrucks oder der Transparenz verlieren an Bedeutung, an ihre Stelle treten Strategien des Kontrasts, der Erfindung und der Paradoxie. Nur sie tragen unserer >chaotischen< Welt voller Überschneidungen und Instabilitäten Rechnung. Störungen und Hybridbildungen entsprechen der postmodernen Lebenserfahrung.“ Nathalie de Vries gab dem
Strahlendes Zeichen der Veränderung ist die Markthal in Rotterdam (https://www.mvrdv.nl/projects/markethall/). Ein Mischwesen aus Öffentlichkeit und intimem Rückzug, großer Geste, großer Tiefgarage und großem Denken. Die auf beiden Seiten aufgetürmten Wohnungen neigen sich zueinander und bilden eine Tonne, unter deren Gewölbe öffentliches Leben und Miteinander stattfindet: wettergeschützt und perfekt erschlossen.




Mit jedem weiteren Projekt verdichtete sich das befreiende Moment hybriden Denkens – vom Ku.Be House of Culture and Movement in Kopenhagen (https://www.mvrdv.nl/projects/KUBEhouseofmovement/), ein Treffpunkt für Menschen von 1-101 Jahren, über den Vorschlag eines begrünten und entschleunigten Flughafens Schiphol (2. Preis, https://www.mvrdv.nl/projects/schiphol-airport-terminal-a), Stadtplanung in Seoul (https://www.mvrdv.nl/projects/seoul-skygarden) und Wohnbauten wie The Valley (https://www.mvrdv.nl/projects/valley) – vertikale Wohnlandschaften in Amsterdam, die aussehen, als hätten die Architekten Säure auf einen Styroporblock gegossen, tatsächlich aber mit Hilfe des Computers optimale Winkel für Balkone und Wohnungen berechnet. „Leben im Hochhaus – das müssen wir noch lernen, als Flachländer“, sagte die Architektin und hatte das Publikum einmal mehr auf Ihrer Seite.
Warum also bauen wir nicht gleich Häuser, die alles in sich tragen, fragte die Architektin zurecht – und es klang wie eine Aufforderung, einige Leitzordner mit Bauvorschriften zu entsorgen. Schließlich gab sie doch einige Hinweise auf das, was sie so schön mit „Untiefe“ bezeichnete: Die Fähigkeit, Mischformen von Anfang an zuzulassen, etwa an der Schwelle von Büroflächen und Mietwohnungen, deren Umwidmung vielleicht doch nicht so schwer sein muss, wie oft erlebt: größere Deckenhöhen als üblich, ein aktives, offenes Erdgeschoss mit Läden und öffentlichen Einrichtungen und ein Schuss undefinierter Flächen.
Hybridität bedeute nämlich „von allem noch etwas mehr machen“ und nach „außen zu gehen.“ Also auf vom Schreibtisch und vom bequemen Sofa und raus ins Leben, unter die Leute, bereit, sich auszutauschen.
Sind wir nicht selbst Hybride, fragte die Architektin zum Schluss – und zahlreiche Gäste stimmten zu.




Text: Dr. Oliver Herwig & Andreas Groß
Fotos: Studio für Gestaltung