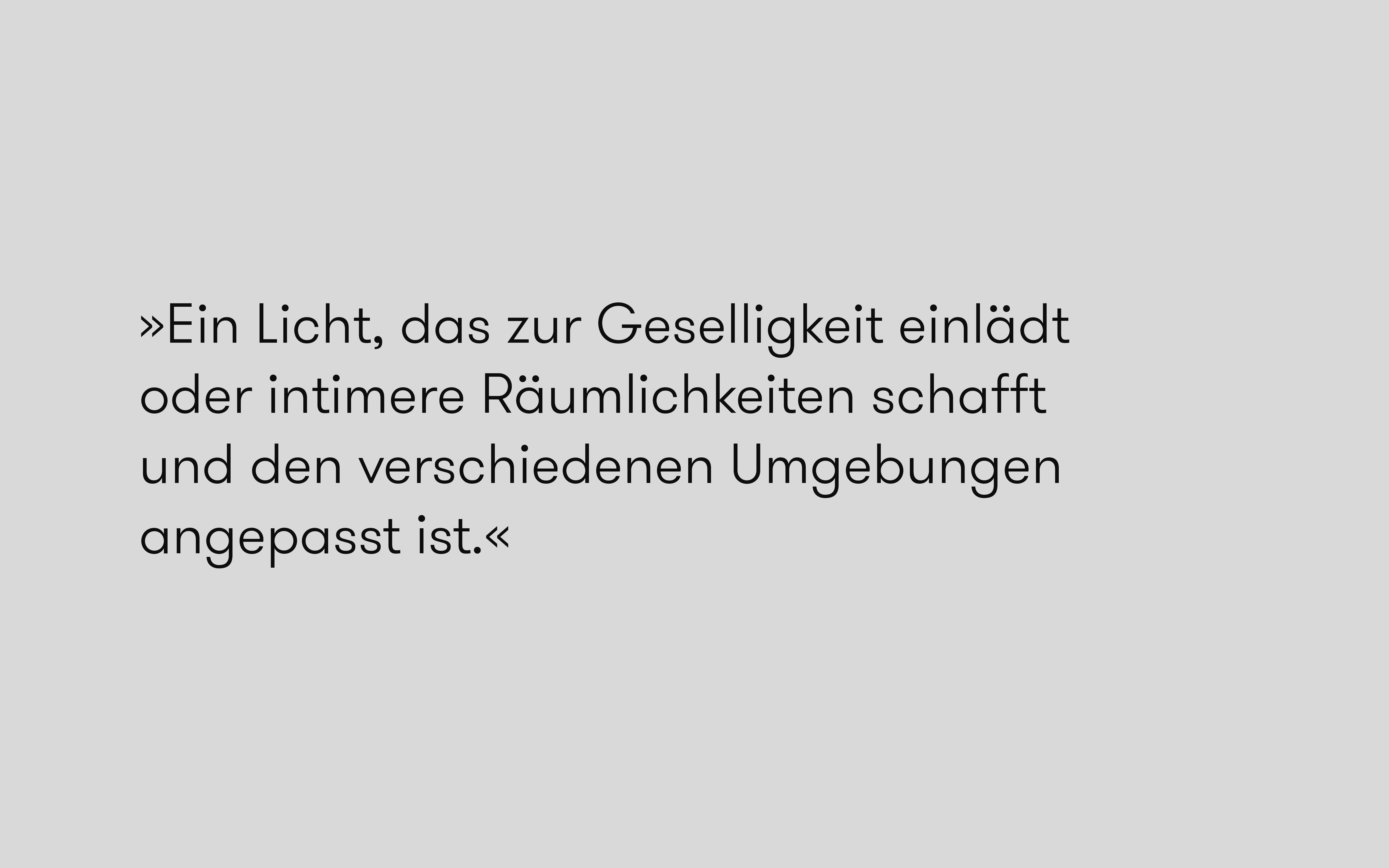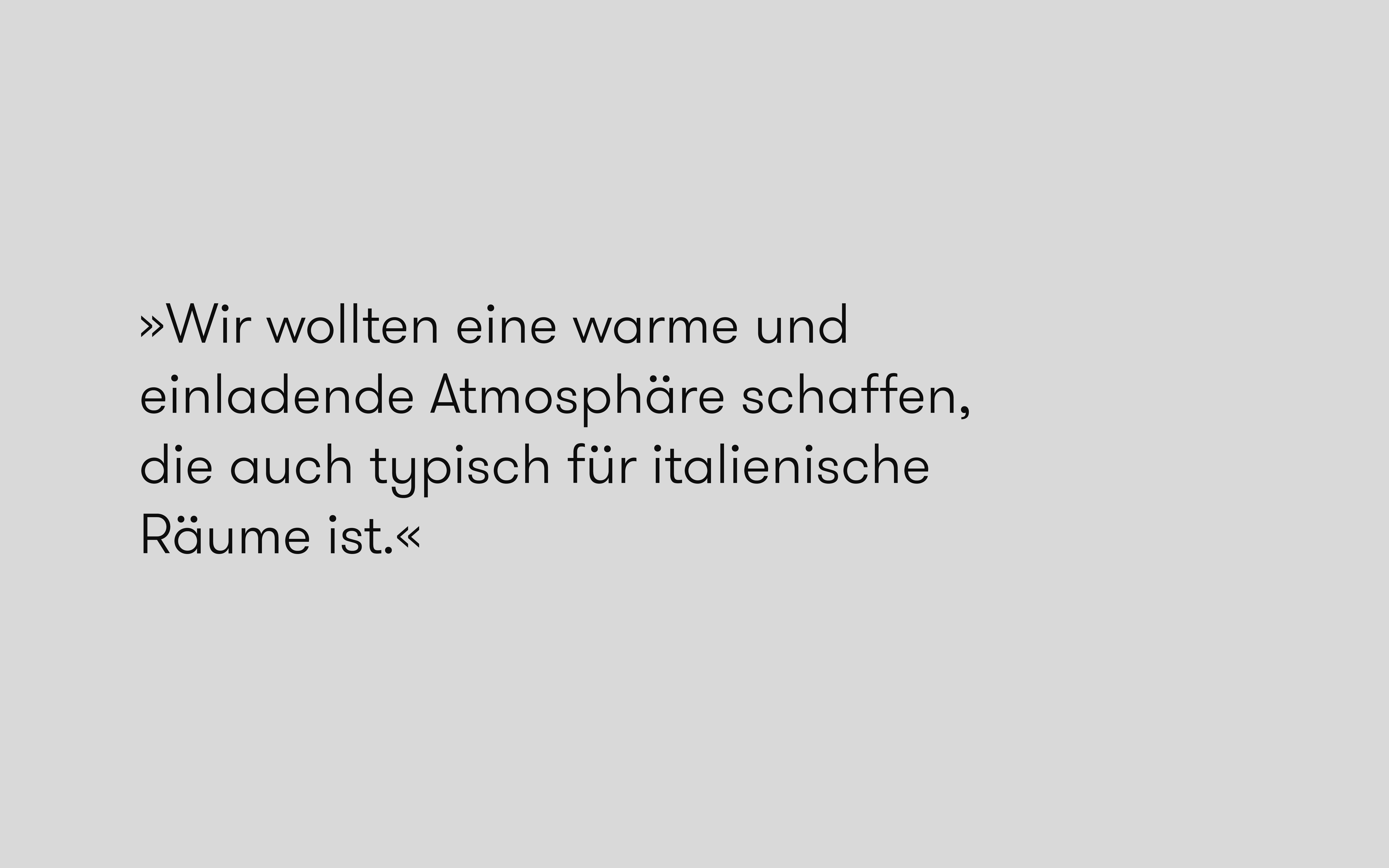Ökologisch im Bauhausstil
GIRA

Aus dem KAP Magazin #10
Das Gebäude bildet den passenden Abschluss einer komplett im Bauhausstil gehaltenen Straße. Durch die großen Glasfronten im Erdgeschoss und die Auskragung des Obergeschosses scheint der obere Quader auf dem unteren zu schweben, das Gebäude wirkt leicht und luftig. Die Dachterrasse ist aus dem Quader herausgestanzt und die Geometrie bleibt durch eine bewusste Fortführung der Kanten erhalten. Der Sonnenschutz ist clever in der Fassade versteckt, um das puristische Gesamtbild nicht zu stören. Durch den Quader im Erdgeschoss schiebt sich zudem ein langgestreckter Riegel, in dem unter anderem die Garage untergebracht ist. Durch das Gefälle zur Straße hin ist diese fast 3 Meter hoch.

»Keller und Erdgeschoss haben wir als Massivbau errichtet, das Obergeschoss in Holzständerbauweise«, erklärt Architektin Dagmar Pemsel. »Die leichtere Konstruktion war nötig, da wir im Erdgeschoss nur wenig tragende Wände und umso mehr Fensterflächen haben. Schlanke Stützen in den Ecken und hinter dem Küchenblock ermöglichen die Statik.« Die tragenden Wände im Erdgeschoss und die Decken sind in Sichtbeton ausgeführt und vor Ort gegossen worden.

Um die Heizkosten möglichst gering zu halten, ist das Haus gut gedämmt: Mit einer 35 cm dicken Schicht unterm Dach und 36 cm Dämmung in den Wänden im OG bzw. 26 cm an den Wänden im EG. Die Fensterflächen machen anteilig am Gebäude etwa 40 % aus, das Erdgeschoss ist sogar zu 60 % verglast. Die Dreifachverglasung mit einer Glasstärke von je 8 mm und mit 12 mm großen Zwischenräumen erreicht einen U-Wert von 0,74 W/m²K. Der Dämmwert der Gebäudehülle insgesamt liegt bei 0,26 W/m²K (EnEV). Ebenfalls ökologisch wertvoll: Das Flachdach ist begrünt.

Geheizt wird mit einer elektrischen Luft-Wärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizung in den Wohnbereichen und einer Wandheizung im Keller. Zur Entlastung der Wärmepumpe besitzt der Kaminofen integrierte Wassertaschen, die beim Befeuern im Winter erhitzt und deren Wasser dem Die geometrisch strenge Form wird auch durch die große Dachterrasse nicht unterbrochen, da der Rahmen fortgeführt wird und die Terrasse wie ausgestanzt erscheint. In der Nähe von Nürnberg ist ein energetisch vorbildliches Haus im geradlinigen Bauhausstil entstanden.

Der obere Kubus scheint durch seine Auskragung und die großen Fensterflächen im Erdgeschoss beinahe zu schweben. Schichtenspeicher für Warm- und Heizungswasser zugeführt wird. Auf dem Dach ist zudem eine 10 m² Solaranlage installiert, die ca. 60—70 % zur Warmwasserversorgung und 15—20 % zur Heizungsunterstützung beiträgt. Eine Lüftungsanlage mit getrennter Zu- und Abluft sowie einem Wärmetauscher sorgt für stetig frische Luft. In Summe ergibt sich ein vorbildlicher Energiekennwert für die Heizwärme von 18 kWh/m²a nach PHPP-Berechnung (Passivhaus Projektierungs- Paket). Zum Vergleich: Der Durchschnittswert in deutschen Einfamilienhäusern liegt bei 160 kWh/m²a, mit 15 kWh/ m²a hätte das Gebäude Passivhausstandard erreicht. Der Primärenergiekennwert liegt bei ca. 60 kWh/m²a.

Ebenerdig erstreckt sich auf fast 120 m² ein großzügiger Raum mit Wohnbereich, Kochinsel und Essbereich, die riesigen Fensterflächen holen die Natur ins Haus. Blickachsen waren ein zentraler Wunsch der Bauherren, aus jeder Perspektive bietet sich ein neuer, faszinierender Ausblick ins Freie. Sichtbetonwände und Decken, weiße Wände und Möbel sowie ein dunkler Holzboden harmonieren miteinander. Eine in Sichtbeton gegossene und trotzdem filigrane Treppe führt ins Obergeschoss: Sie wurde im Betonwerk individuell gegossen und später mit einem Kran millimetergenau in den Rohbau eingepasst.

Im Obergeschoss gelangt man in die privaten Räume. Hier befinden sich das Kinderzimmer, Büro, Schlafzimmer und ein 24 m² großes Wellness-Bad mit freistehender Wanne, Sauna und direktem Zugang zur Dachterrasse. Von dort lässt sich der grandiose Blick über die angrenzenden Felder und auf die »Skyline« von Nürnberg genießen.

Die technikaffinen Bauherren wollten mit ihrem Traumhaus auch ein zukunftsfähiges, intelligentes Haus bauen. Daher entschieden sie sich für ein KNX-System, das alle Komponenten der Haustechnik miteinander vernetzt. Das »Gehirn« hinter dem Bussystem ist ein leistungsstarker Gira HomeServer, in dem sämtliche Informationen zusammenlaufen, ausgewertet und entsprechende Befehle an sogenannte Aktoren gesendet wer den.


Gesteuert wird daheim oder von unterwegs übers iPad oder iPhone: Die Gira Visualisierung ist selbsterklärend. Alle Leuchten im Haus lassen sich von hier aus aktivieren, Jalousien hoch- und runterfahren, die Heizung regulieren und vieles mehr. Einige Funktionen laufen auch automatisch im Hintergrund ab: Meldet die Gira Wetterstation starken Wind, fahren die Jalousien hoch. Geplant, installiert und programmiert wurde die Gebäudetechnik von System-Integrator Klaus Geyer: »Praktisch ist, dass sich das System jederzeit umprogrammieren, den Bedürfnissen anpassen und aufrüsten lässt – ohne die Wände aufreißen zu müssen, denn die Infrastruktur liegt ja bereits.«

Auf Gira Tastsensoren in den Räumen lassen sich ganze Szenen abrufen, beispielsweise eine reduzierte Lichtszene mit heruntergefahrenen Jalousien zum Kinoabend oder eine gezielte Beleuchtung am Esstisch mit dezenter Hintergrundmusik. »Vor Verlassen des Hauses können mit einem Tastendruck alle Energiequellen im Haus deaktiviert werden«, erklärt Klaus Geyer einen cleveren Weg, Energie zu sparen.

Leuchten und Lautsprecher sind zum Teil dezent in die Architektur integriert als Decken oder Wandeinbauvarianten. Ein Multiroom- System versorgt unabhängig voneinander vier Zonen mit Musik von zentralen Audioquellen aus. Die Gira Schalterprogramme Esprit Glas Weiß und E2 Reinweiß passen bestens zur puristischen Architektur.

Die Gira Türkommunikation mit Videofunktion sorgt für Sicherheit: So lässt sich jederzeit sehen, wer vor der Tür steht und klingelt. Dank einer Kopplung mit Skype über ein spezielles Gira TKS-IP-Gateway kann auch mobil kommuniziert werden, via iPhone, iPad sowie allen Smartphones und Tablets, für die die Skype App erhältlich ist. So lässt sich das Gespräch mit dem Besucher inklusive Video des Klingelnden führen und bei Bedarf kann auch der Türöffner ausgelöst werden.
Fotos © Ulrich Beuttenmüller