QUO VADIS CITY?
Impulse für die Zukunft unserer InnenStädte.
Teil 1
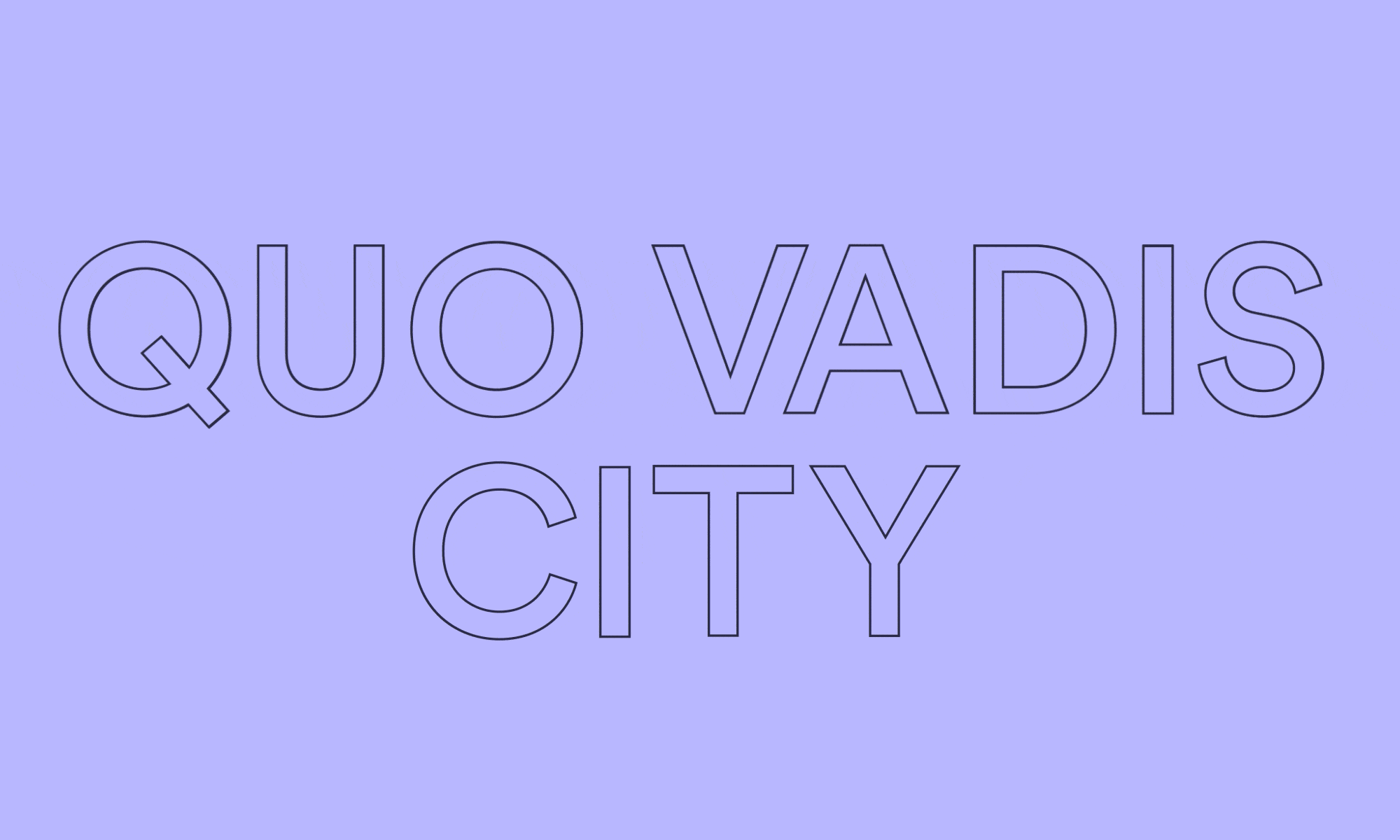
Unsere Cities stecken in der Krise. Viele InnenStädte leiden unter Leerstand, Ödnis und Langeweile, drohen im Verkehr zu ersticken. 72% der Bürger:innen wünschen sich eine Veränderung der InnenStädte (Quelle: GfK). Welche Ansprüche hat die Gesellschaft an eine lebenswerte InnenStadt und welche Alternativen gibt es zum Status quo?
Krise bedeutet immer auch Chance. Chance, unsere InnenStädte neu zu erfinden, wieder zu beleben, spannend zu gestalten, vielfältig zu nutzen.
Das KAP Forum möchte zum Jahresbeginn 2024 zum Weiterdenken der City anregen und fragt Stadtplaner, Architekten, Investoren, ImmobilienWirtschaft, Wissenschaftler, Unternehmer und engagierte Bürger:
1. Worin liegt der Niedergang unserer InnenStädte begründet?
2. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die City für die Städte und Bürger:innen? Brauchen wir die City noch als zentralen Ort in der Stadt – oder hat sie sich überlebt?
3. Wie sieht die InnenStadt von morgen aus? Wie können die InnenStädte revitalisiert werden und wieder an Bedeutung gewinnen. Welche InnenStädte können aus Ihrer Sicht beispielhaft für die notwendige Transformation stehen?

Tina Unruh
Tina Unruh ist Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung Baukultur (HSBK) und stellvertretende Geschäftsführerin der Hamburgischen Architektenkammer.
Baukultur, lebendiger Austausch und ein gutes Miteinander
Wir Menschen sind soziale Wesen. Beziehungen zueinander sind für uns ebenso wichtig, wie das Gefühl der Zugehörigkeit, das sich aus gemeinsamen Merkmalen, gleichen Interessen oder demselben Lebensraum ergibt. Möglichkeiten zur Identifikation bieten beispielsweise Kulturbauten, repräsentative Stadträume und öffentliche Gebäude. Innenstädte verfügen über eine hohe Dichte solcher Orte, die unser kommunales Selbstverständnis anschaulich machen. Gerade die Kerne europäischer Städte bieten zahlreiche Räume der Begegnung und der Vergemeinschaftung und bewahren Teile unserer Geschichte in ihrer Gestalt.
Die lang andauernde Ausrichtung auf permanentes Wirtschaftswachstum führte beispielsweise zu einer extremen Konsumorientierung. Es folgte der hohe Verwertungsdruck für Grundstücke in zentralen Lagen sowie die Fokussierung auf Nutzungen mit höchsten Renditeversprechen: Flächen für den Verkauf global agierender Marken und für Dienstleistungen zunehmend internationaler Konzerne.
Doch die aktuellen Herausforderungen wie die Digitalisierung, die zu starken Verschiebungen im Handel führt, aber auch die Klimakrise oder der demografische Wandel, erfordern Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Entscheidend für Reaktionsschnelligkeit, Widerstandsfähigkeit und Verlässlichkeit ist das Maß an Diversität. Fehlt diese, wie in den monofunktionalen Zentren, entwickelt der Wegfall von Verkaufsflächen eine selbstverstärkende Sogwirkung – die Verödung der Innenstädte. Multifunktional genutzte Stadträume hingegen gleichen den abrupten Ausfall Einzelner schnell aus, die Handlungsfähigkeit der Akteure*innen bleibt erhalten.
Um lokalen Handel und Produktion, Wohnraum und kulturelle Angebote, Handwerk und Kreativwirtschaft zurück in die Zentren zu holen, müssen sich bestehende Strukturen öffnen: Experimentelle Ansätze wie Zwischennutzungen loten Möglichkeiten aus. Mit der HSBK gehen wir bewusst an Orte des Wandels, wie für Workshops in ehemalige Schuhläden, mit Ausstellungen in ungenutzte Kaufhäuser und mit baukulturellen Veranstaltungen in leere Lagerhallen. Auf Zwischennutzungen können Umnutzungen folgen und die erwünschte Diversität in die Stadt bringen. Beispielsweise zieht in Hamburg eine Schule in ein ehemaliges Einkaufszentrum und direkt am Hauptbahnhof steht seit Mai 2022 ein Kreativ-Kaufhaus mit Kunst-, Kultur- und auch konsumfreien Angeboten zur Verfügung.
Hierfür bedarf es mutiger Entscheidungen, etwas Pioniergeist und viel kluger Planung, die von dem Erhalt bestehender Bausubstanz ausgeht, um das lineare Wirtschaftswachstum in zirkuläre Systeme zu überführen. Mit temporären Umbauten versucht die HSBK hier Impulse zu geben und gestaltet alle Anlässe kreislaufgerecht. Darüber hinaus zeigen wir in der Ausstellung #Stadtgestalt im Klimawandel verschiedene Bauprojekte mit diesem, aber auch weiteren Ansätzen für nachhaltiges Planen und Bauen.
Ebenso wichtig wie die Vielfalt an Angeboten in unseren Zentren, ist auch die Vielfalt der Akteur*innen: Weder „der Markt“ noch „die Politik“ oder die Stadtgesellschaft alleine können auf den Wandel reagieren. Die komplexen Zusammenhänge der Immobilienwelt sind auch für Nutzende transparenter zu machen. Dieser Perspektivwechsel muss gelingen, denn die Räume in unserer Stadt sollten wir unbedingt gemeinsam weiter entwickeln!
Baukultur trägt konstruktiv dazu bei, Lösungen für alle zu erarbeiten, unter technischen, wirtschaftlichen und immer auch unter gestalterischen Aspekten. Dafür bedarf es der Perspektive Vieler und eines lebendigen Diskurses miteinander. Seit 20 Jahren bietet das KAP Forum eine Plattform für den Austausch – die Hamburger Stiftung Baukultur, 2 Jahre jung, gratuliert sehr herzlich!
Tina Unruh ist Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung Baukultur (HSBK) und stellvertretende Geschäftsführerin der Hamburgischen Architektenkammer. Sie setzt sich für die Entwicklung von städtischen Räumen gemeinsam mit den Menschen vor Ort ein und bringt dafür Erfahrungen aus der architektonischen Praxis, der Forschung und Lehre sowie gemeinwohlorientierter Immobilienentwicklung mit. Nach ihrem Studium und langjähriger Arbeit als angestellte und später als selbstständige Architektin war sie ab 2005 an der Hochschule Luzern Professorin im Masterstudiengang. Seit 2017 ist Unruh in der Hamburgischen Architektenkammer tätig und hat die Gründung der Hamburger Stiftung Baukultur begleitet, die sie heute leitet. Sie ist Gründungsmitglied der Genossenschaft Gröninger Hof eG sowie Vorsitzende im Aufsichtsrat.

Hilmar von Lojewski
seit 2012 Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr für den Städtetag Nordrhein-Westfalen und den Deutschen Städtetag
Foto: © Deutscher Städtetag/Frank Nürnberger
Essentials zur Zukunft der Innenstädte und Stadtteilzentren
Nicht erst seit der Corona-Pandemie und angesichts der vermutlich sechsten (?) Pleitewelle der angestammten Kaufhäuser – diesmal mehr getrieben durch die pervertierte Vermietungspraxis als durch weiter fallende Umsätze – zeichnet sich ein Wandel in den Innenstädten ab. Weitere große Körnungen fallen leer und können über Jahre nicht wieder gefüllt werden, Trading down-Effekte durch zu langen Leerstand und Missachtung öffentlicher Räume setzen ein, Immobilien- und baukulturelle Werte werden vernichtet, vormals Lieblingsorte werden zu schwierigen Lagen oder gar Unorten. Denn unabweisbar gilt – nicht mehr der Konsum ist Hauptanlass für den Besuch der Innenstädte. Wo liegen die Lösungen?
Das Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft in Innenstädten und Stadteilzentren muss sich ändern.
Wohnen gehört zur Nutzungsmischung ebenso dazu wie Handel, Gastronomie, Kultur und Bildung. Um weniger ertragsträchtige Nutzungen (wieder) in die Innenstädte zu bringen, bedarf es eines Sinneswandels in der Immobilienwirtschaft. Ob durch ESG-Standards oder durch bessere Einsicht und immobilienwirtschaftliche Nachhaltigkeit getrieben – Renditeoptimierung ohne Engagement für die eigene Immobilie und ihr Umfeld funktioniert nicht mehr ohne Weiteres in den Innenstädten und noch weniger in den Stadtteilzentren. Eigentümer, Gesellschaften, Fondsmanager und wer immer in die Innenstädte und Stadtteilzentren investiert hat oder investieren will, müssen lernen, Phantasie zu entwickeln, Nutzungen gut zu mischen, deutlich mehr als vielleicht bislang schon Quersubventionierung für die wichtigen aber weniger ertragreichen Nutzungen zu üben und über die eigene Parzelle hinauszuschauen und zu handeln.
Die öffentlichen Räume und die sie umgebenden Architektur müssen durch zielgenaues und nachhaltiges Investieren aufgewertet werden.
Das bedeutet keineswegs, zum Beispiel die bisweilen ungeliebte Kaufhausarchitektur der wilden Konsumjahre zu entsorgen. Aber sie aufzunehmen, anzupassen, weiterzuentwickeln und mit neuen Inhalten und neue Konnotationen in der Wahrnehmung durch die Menschen zu provozieren, ist die eigentliche Herausforderung. Und die öffentlichen Räume müssen auch jenseits der prominenten Plätze Gestaltungs- und Pflegeliebe erfahren. Hinzu treten noch die vielfältiger werdenden Ansprüche an Erholung, Kühlung, Versickerung. Beileibe keine leichte Aufgabe, die private wie öffentliche Investoren zu stellen und die Fachdisziplinen mit begrenzten Ressourcen auf dichtem Stadtraum in den allfälligen diskursiven und partizipativen Prozessen mit der stets kritischen Öffentlichkeit zu erfüllen haben.
Alle Menschen, die mit den zentralen Orten ihrer Stadt etwas zu tun haben wollen, müssen aktiviert werden.
Das muss nicht bedeuten, dass auch alle Beteiligten die planerischen und gebauten Ergebnisse zu Architektur, Städtebau, Grün in der Stadt, Nutzungen und Mobilität akzeptieren müssen. Oft fällt der Groschen erst zeitverzögert, zum Beispiel nach einer umkämpften „Zivilisierung des motorisierten Individualverkehrs“ in den Innenstädten und Stadtteilzentren. Argumente, wie „Rad- und Fußverkehr binden mehr Kaufkraft als der MIV“ sind zwar belegbar, bleiben aber streitbefangen. Abschied vom Kaufhaus und Willkommen für quirlige Zwischen- und ungewohnte Endnutzungen sind kein Selbstläufer. Und dennoch – es muss wieder bildhafte Lust auf die Innenstadt und Stadtteilzentren geweckt werden. Das geht nur über Prozesse der Beteiligung und Teilhabe an den verschiedenen „guten Stuben“ der Städte – den prächtigen Salons in den zentralen Bereichen genauso wie den häufig ungeliebten Umfeldern der Bahnhöfe, den profanen Orten zur „Deckung des täglichen Bedarfs“ in gleicher Weise wie den verschwiegenen wie oft vernachlässigten Lieblingsorten im Quartierszentrum.
Die boden- und baurechtlichen Instrumente, die für die Transformation von Innenstädten und Stadtteilzentren unverzichtbar sind, müssen nachjustiert werden.
Es darf nicht mehr passieren, dass Städte zur Untätigkeit verdammt sind, wenn Leerstände entstehen, die absehbar nicht mehr gefüllt werden, dass sie Jahre benötigen, um überhaupt verantwortliche Grundstückseigentümer zu identifizieren, bei Zwangsversteigerungen in die Röhre gucken und die ohnehin schon milden Zwangsinstrumente zur Bestandssicherung ins Leere laufen. Und umgekehrt darf es den einfallsreichen Investoren nicht passieren, dass sie jahrelang auf das Ändern, Aufheben oder Aufstellen von Bebauungsplänen warten müssen, um im baulichen Bestand Neues entstehen zu lassen. Und sie müssen auch davon entlastet werden, bestehende Gebäude faktisch nur im Neubaustandard umnutzen zu dürfen. Da geht die beste Investitionsidee qua Zeitablauf vor die Hunde.
Anders Investieren, Erhalten und Erneuern, vielfältige Nutzungen und gute Gestaltung mit breiter Beteiligungsarbeit zu paaren passiert nicht von selbst – all dies erfordert ein sorgfältiges Kuratieren von Innenstädten und Stadtteilzentren. Das kann durchaus eine privat-öffentliche Aufgabe sein, wenn die Privaten mitmachen. Aber es ist in jedem Fall mehr als Innenstadtmanagement. Übrigens – die Stadtteilzentren fallen bei der Betrachtung schnell hinten runter. Aber wer eine 15-Minuten-Stadt will, darf sich nicht nur um die Innenstädte kümmern, sondern muss das Augenmerk auf die Stadtteilzentren legen. Für die Neukodierung aller dieser Orte gibt es keine Patentlösungen. Vielmehr bietet der Genius Loci Möglichkeiten für Neues und Wandel – und den müssen sich alle mit der Transformation Befassten erstmal ergucken, erlaufen, erradeln, erfühlen – und gewiss auch erfahren.
Hilmar von Lojewski ist seit 2012 Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr für den Städtetag Nordrhein-Westfalen und den Deutschen Städtetag. Er studierte bis 1988 Raumplanung sowie Stadt- und Regionalplanung in Dortmund und Ankara, war bis 1991 Städtebaureferendar in Frankfurt/Main und arbeitete als freier Planer und Planungsbeamter in Dortmund, Kathmandu, Dresden, Berlin und Damaskus.

Andreas Kipar
Dott.Arch. Dipl.-Ing., Landschaftsarchitekt & Stadtplaner, Geschäftsführender Gesellschafter des Beratungs- und Planungsunternehmen LAND mit Niederlassungen in Mailand, Düsseldorf, Wien, Lugano und Montreal
Foto: © Copyright: Ralph Richter
Ein Einwurf von Andreas Kipar
Die Gründe ihres Niedergangs sind bekannt. Aus einer sich monofunktional zum Einkaufszentrum entwickelten Innenstadt ohne Wohn- und Erlebnisräume wurden die Menschen vertrieben. Sie reisten nur noch zum Shopping an. Die Sucht nach Kapitalrenditen ließ kulturelle Anregungen, soziale Treffpunkte, gastronomische Angebote von Qualität und nicht kommerzielle Arbeitsplätze verkümmern. Internet, der zunehmende Onlinehandel und ein verändertes Konsumverhalten hatten den stationären Einzelhandel und die Warenhäuser bereits in eine Krise gestürzt, als Covid ihnen den Garaus machte und die Innenstädte endgültig verödeten.
Die wachsenden, immer mehr Menschen fesselnden urbanen Räume sind aber auf sozial und kulturell lebendige, auf touristisch und wirtschaftlich attraktive Zentren angewiesen, durch die städtische Gemeinwesen einen Zusammenhalt entwickeln können. Nur ein anziehendes Zentrum verhindert, dass urbane Gürtel und Randbereiche sich ghettoisieren oder verwahrlosen. Ohne eine City verliert eine Stadt sprichwörtlich ihre Mitte, ihren Halt und wird zu einem Konglomerat mäandernder Räume.
Auch das ist bekannt: Die Innenstadt von morgen muss sich unter der Prämisse der Nachhaltigkeit durch eine Mischnutzung aus Wohnen und Produzieren, aus Arbeit, Handel und Kultur entwickeln. Zentren vermitteln für die Demokratie wichtige Identitäten, indem sie die Repräsentation historischer, politischer und gesellschaftlicher Einrichtungen mit dem Erlebnis von Freiräumen und mit sozialen Treffpunkten verbinden. Es geht um Zentralitäten, die sich bereits in den jeweiligen, immer mehr an Bedeutung gewinnenden Stadtvierteln herausbilden. Sie werden durch ein Netz grün/blauer Infrastrukturen verbunden, das sanfte Mobilität favorisiert und die Stadt auch in der City aus unbebauten Flächen neu entdecken lässt – ansatzweise zum Beispiel in Essen durch die „Neuen Wege zum Wasser“.
Wenn das alles bekannt ist, dann ist ein Paradigmenwechsel gefordert. Die Stadt darf nicht länger allein nach gewinnorientierten Interessen organisiert werden. Gute Zureden bleibt letztlich hilflos. Es braucht Verpflichtungen. Gesellschaften etwa in Deutschland (Artikel 14 Grundgesetz) oder Italien (Artikel 42/43 der Verfassung) haben durch die soziale Verpflichtung des Eigentums einen Interessenausgleich und eine demokratisch organisierte Entwicklung ermöglicht. Jetzt muss auch eine durch die Verfassung garantierte ökologische Verpflichtung des Eigentums dazu kommen.
Nur wenn wir die alten Verhältnisse aufbrechen, geben wir der Innenstadt von morgen, die auf der Stadt von heute aufbaut, eine Entwicklungschance. Zum Beispiel in der Düsseldorfer Friedrichstraße. Es muss wehtun, etwa durch Einschränkung des Autoverkehrs wie in Mailand durch das Projekt der Neuorientierung des Piazzale Loreto. Der wird von einer ebenerdigen Verkehrsdrehscheibe zu einer mehrstöckigen Drehscheibe für Menschen umgestaltet, die in das dahinterliegende Viertel ausstrahlt, es entwickelt und gleichzeitig zur Mailänder Innenstadt in eine neue Beziehung setzt.
Andreas Kipar, Dott.Arch. Dipl.-Ing., Landschaftsarchitekt & Stadtplaner, Geschäftsführender Gesellschafter des Beratungs- und Planungsunternehmen LAND mit Niederlassungen in Mailand, Düsseldorf, Wien, Lugano und Montreal.
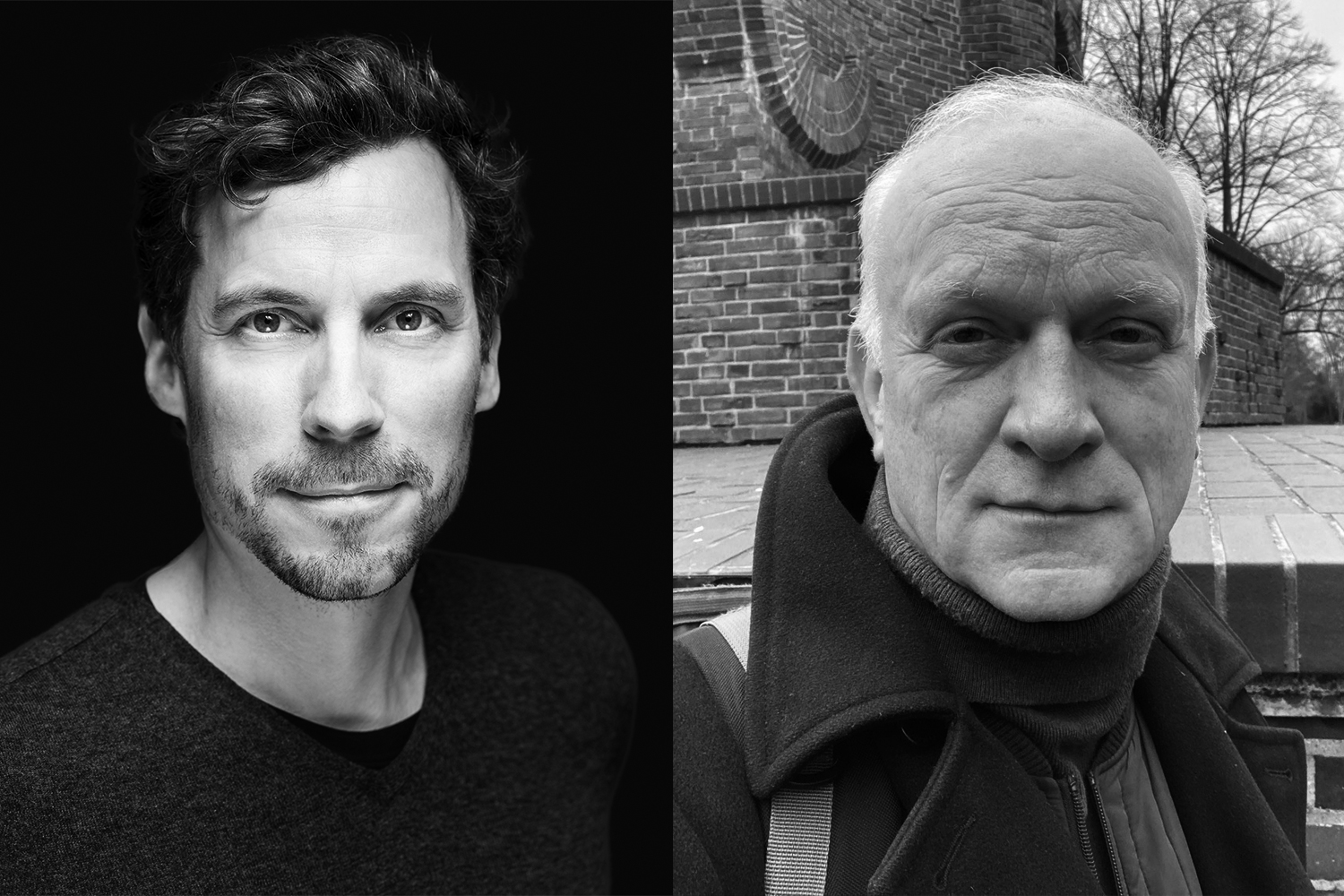
Tim Rieniets & Christoph Grafe
Tim Rieniets ist seit 2018 Professor am Institut für Entwerfen und Städtebau der Leibniz Universität Hannover. Christoph Grafe (Bremen, 1964); Architekt, Kurator und Publizist. Professor für Architekturgeschichte und -theorie, Bergische Universität Wuppertal.
Foto links: © Copyright: Julian Martins
Transformationsprojekt Innenstadt
Die deutschen Innenstädte waren lange Zeit ein verlässlicher Fixpunkt in einer sich schnell verändernden Welt. Wir gingen dort aus, trafen Bekannte und manchmal versammelten sich dort die Fans erfolgreicher Fußballmannschaften, um ihren Verein zu feiern. Vor allem aber gingen wir dort einkaufen. Die deutsche Innenstadt, oder „City“, ist vielleicht die folgenreichste städtebauliche Erfindung der Wirtschaftswunderjahre.
Die Innenstädte boten aber nicht nur kurzweilige Einkaufserlebnisse, sondern waren zugleich der wichtigste Bezugspunkt für die kollektive Identität der Stadtgesellschaft: Geschichtliche Zeugnisse, monumentale Bauwerke und die Orte kommunaler Politik und Verwaltung verdichteten sich hier zum unverwechselbaren Erscheinungsbild der Stadt. Daran hat sich in der Sache nichts geändert, selbst wenn die Dominanz des Einzelhandels dazu geführt haben mag, dass die kollektive Wirkung der Innenstädte schwächer geworden ist.
Anders ergeht es derzeit dem Einzelhandel. Die Gewissheit, dass der Stadtkern als Zentrum des Handels eine besondere Rolle in der städtischen Ökonomie spielt, ist zuletzt einer neuen Unsicherheit gewichen. Der Konkurrenzkampf im stationären Einzelhandel und der Aufstieg des Online-Handels haben schon lange ihre Spuren im Stadtbild hinterlassen, auch und ganz besonders in den Innenstädten.
Kaufhausketten, die einst als fester Bestandteil und „Anker“ einer jeden Innenstadt galten, sind verschwunden oder werden noch aufgegeben. Ob das Konzept Warenhaus im gehobenen Segment in Metropolen erhalten bleibt? Selbst das ist mittlerweile eine Frage. Zuletzt zeigte die Pandemie, dass viele Menschen die Innenstädte eigentlich nicht mehr brauchen – zumindest nicht zum Einkaufen.
Aber welche Aufgabe können oder sollen die Innenstädte sonst übernehmen? An dieser Frage hat sich seit Corona eine lebhafte Debatte entzündet. Die Antwort darauf sollten aber nicht einen „everything goes“ entspringen, sondern sich an jenen Themen orientieren, die für eine nachhaltige Entwicklung der Innenstädte maßgeblich sind die. Da wäre zum einen der bauliche Bestand, der in vielen deutschen Innenstädten stark durch die Architektur des Wiederaufbaus geprägt ist.
Dieses Erbe lässt sich – etwas vereinfacht – in einige wenige bauliche und städtebauliche Typen gliedern. Da ist zunächst das Großwarenhaus als funktionales Gehäuse für den modernen Massenkonsum. Dann die Parkhäuser, der zweite großmaßstäbliche Bautyp, der während der Wirtschaftswunderzeit in den Innenstädten eingeführt wurde und bis heute ihr Aussehen prägt. Und zuletzt das Geschäftshaus mit Ladenflächen im Erdgeschoss, und Wohn und Büroräume darüber, welches den größten Teil des Bestandes ausmacht. Dazwischen liegt die Fußgängerzone, welche die Mutation des Stadtkerns zur Einkaufscity vervollkommnete. Sie ging einher mit einer beispiellosen funktionellen und sozialen Entflechtung einher, die sich überall nach Geschäftsschluss zeigt.
Viele Häuser bedürfen einer grundsätzlichen Neuinterpretation, wenn sie eine neue Vielfalt von Nutzungen und Aktivitäten ermöglichen sollen. Dabei sind die Ausgangslagen der vorherrschenden Bautypen – des Geschäftshauses, des Warenhauses und des Parkhauses – jeweils unterschiedlich. Jeder dieser Typen hat seine eigene Entstehungsgeschichte, ist belastet mit unterschiedlichen ökonomischen Erwartungsgeflechten und hat spezifische bautechnische Eigenschaften. Für die neue Ausrichtung dieser Gebäude ist nicht nur architektonisches Geschick gefragt, sondern auch viel Erfindungsreichtum bei der Entwicklung geeigneter Finanzierungs-, Betreiber- und Nutzungsmodelle.
Zum anderen sollte sich die Transformation der Innenstädte daran orientieren, was sie für die gesamte Stadt und ihre Bewohnerinnen leisten soll – nicht nur baulich und funktional sondern auch sozial und emotional . Gerade die Innenstädte sind Orte der Ankunft und gemeinsamer Erfahrungen, und ein Schauplatz für das Finden von Gemeinsamkeit, wie das Aushandeln von verschiedenen Interessen. Der Einzelhandel wird sicher auch in der Zukunft ein wichtiges Element bleiben und die Innenstädte damit zum Experimentierfeld für neue (und manchmal auch wiederentdeckte) Formen der kleinteiligen Produktion und des Tausches von Waren machen. Vielleicht ist aber auch das letzte Wort über die vollständige Verbannung des motorisierten Verkehrs in den Innenstädten noch nicht gesprochen. Vielleicht muss auch das Konzept der Fußgängerzone überdacht werden. Die flexiblen Konzepte für verkehrsarme Zonen in den italienischen Stadtzentren können hier als Inspiration dienen. Und von Italien ist noch mehr zu lernen: Das Leitbild für die Transformation der Innenstädte muss vom Bestand ausgehen, von der Idee einer dynamischen Kontinuität, damit die Geschichte weitergeschrieben und die Innenstädte als sinn- und gemeinschaftsstiftende Orte erlebt werden können.
Tim Rieniets & Christoph Grafe
Tim Rieniets ist seit 2018 Professor am Institut für Entwerten und Städtebau der Leibniz Universität Hannover. Er forscht und publiziert seit vielen Jahren zum Thema Bauen mit Bestand. Außerdem befasst er sich seit der Corona-Pandemie intensiv mit der baulichen und programmatischen Transformation von Innenstädten.
Christoph Grafe (Bremen, 1964); Architekt, Kurator und Publizist. Professor für Architekturgeschichte und -theorie, Bergische Universität Wuppertal. Direktor des Flanders Architecture Institute in Antwerpen (2017-2019) und Interim Stadtbaumeister in Antwerpen (2015). Gastprofessuren in Hasselt (Belgien) und Mailand. Autor von People’s Palaces – Architecture, Culture and Democracy in post-war Western Europe und Umbaukultur – Für eine Architektur des Veränderns (mit Tim Rieniets). Redakteur von Oase Journal of Architecture und Herausgeber/ Verleger der Eselsohren.

Theresa Keilhacker
Dipl.-Ing. Theresa Keilhacker ist freischaffende Architektin und Urban Design Consultant mit Büro in Berlin
Foto: © Bettina Keller Fotografie
Lang lebe die tot geglaubte City
Post-Corona-Folgen, Konkurrenz durch den Onlinehandel, niedrige Konsumstimmung und daraus folgend zunehmender Leerstand stellen selbst für ehemals lukrative Innenstadtlagen zunehmend ein Problem dar. Hinzu kommt, dass die Mischung aus den immer gleichen Großketten in immer ähnlicher erscheinenden Investorengewändern, ihre Banalität und Tristesse selbst nicht durch effekthascherische Lichteffekte und Großwerbung mehr überspielen können. Ob Düsseldorf, Frankfurt, München oder Berlin, jede City in Deutschland lässt die andere zum Verwechseln ähnlich aussehen. Warenhausketten wie Galeria Karstadt Kaufhof haben Hilfen aus Steuermitteln in Höhe von ca. 700 Mio. Euro und zahlreiche baurechtliche Zugeständnisse erhalten, um ihren Niedergang doch nur um ein paar Jahre zu verzögern. Die SIGNA-Insolvenzen sind symptomatisch und hinterlassen große Fragezeichen. Wo Baugrund von Vermietung getrennt in weit verschachtelte Unternehmensstrukturen aufgeteilt wird, lässt sich schwer eine integrative Stadtentwicklung betreiben. Bevor Politik und Verwaltung sich nun den nächsten Rettungsaktionen zuwenden ist ein guter Moment, um mit etwas Abstand auf die Situation zu schauen.
Die City (oder auch „CBD – Central Business District“) wurde durch die Stadtstrukturmodelle der Chicago School bereits 1925 von Ernest Watson Burgess beschrieben. Sie ist dieser Zeit entsprechend Kennzeichen einer industriell geprägten Stadt mit einer strengen räumlichen Trennung zwischen Arbeit und Wohnen geworden. Und so wie viele große Industrieanlagen aus den Stadtbildern westlicher Städte verschwunden sind bzw. sie heute als Wohn-, Kultur- oder Bürostandorte umgenutzt werden, so geht es heute den Kaufhäusern, Einkaufscentern und Ladenpassagen.
Ist die Umnutzung aller Kaufhäuser in Bürostandorte, wie sie etwa der nun insolvente SIGNA- Konzern für viele Karstadt-Standorte geplant hatte, die einzige Lösung? In Zeiten zunehmender Verbreitung von Homeoffice wohl kaum. Vielmehr würde es sich lohnen, den Gedanken eines CBD wie er noch in Burgess‘ Ringmodell beschrieben wurde, durch das zeitgenössische Modell einer polyzentralen Netzwerkstadt zu aktualisieren: statt monofunktionaler Geschäftsstraßen, die sich nach Ladenschluss in menschenleere Glas- und Betonwüsten verwandeln, muss die Innenstadt wieder zu einem Lebensraum werden. Statt der immergleichen Ketten braucht es ein kuratiertes, interessantes Angebot zumindest in den Erdgeschoßzonen.
Wie das geht, hat etwa Paris gezeigt: In ausgewiesenen Vierteln besitzt die städtische Gesellschaft semaest ein Vorkaufsrecht für Ladenlokale. Diese vermietet sie dann deutlich unter der marktüblichen Miete weiter. Spezialisiert auf die Wiederbelebung des lokalen Handels und Handwerks wurden so bisher mehr als 800 Geschäftsräume für die Unterbringung unabhängiger Händler und Handwerker umgestaltet. Ausgewählt wird, wessen Sortiment am besten in das Viertel passt.
Auch eine Ausweitung des Zweckentfremdungsverbots auf Einzelhandelsflächen wäre denkbar, um spekulativen Leerstand zu unterbinden und durch eine Vergrößerung des Angebots, die Preise nach unten zu regulieren. Denn auch in Innenstadtlagen müssen nichtkommerzielle Aufenthaltsorte mit sozialer Infrastruktur, wie zum Beispiel eine Stadtteilbibliothek oder vielfältige Beratungsangebote möglich sein.
Die letzten 30 Jahre kannten die Mietpreise für Einzelhandelsflächen nur eine Richtung: Nach oben. Die Mieten für die Top-Lagen, also die obersten 3-5% des Segments, lagen 2022 für Berlin im Mittel bei 255,- Euro – pro Quadratmeter! Dies stellt bereits einen Rückgang vom Spitzenwert 310,- Euro/m² in den Jahren 2016- 2018 dar und ist der erste Rückgang der Einzelhandelsmietpreise seit den 1990er Jahren. Durch immer neue Mietpreissteigerungen wurden über die Jahre immer mehr Einzelhändler aus den Innenstädten und damit oft auch zur kompletten Geschäftsaufgabe gedrängt bis nur noch die großen Ketten übrig blieben. Diese vor allem im Bereich Bekleidung und Elektronik tätigen Ketten spüren die Konkurrenz durch den Onlinehandel jetzt besonders stark.
Viele Eigentümer scheinen noch darauf zu hoffen, dass es sich bei ihren Immobilien eher um einen konjunkturellen Leerstand handelt und nicht um einen strategischen, also dauerhaften. Deshalb müssen Stadt- und Bezirksverordnete jetzt das Ruder in die Hand nehmen und ihre Haushalte für die Transformation der Innenstädte umrüsten. Unterstützt von Bundesprogrammen wie „Lebendige Zentren“, oder „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“, können Stadt- und Ortsteilzentren durch die Rückgewinnung versiegelter und öder Flächen attraktiver werden. Wir bringen dafür mit unserer Planungszunft im Innen- wie Außenraum, kreative Umbaukultur-Kompetenz mit in den Prozess. Um die tot geglaubte City wieder zu einem identitätsstiftenden Standort für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur zu transformieren.
Dipl.-Ing. Theresa Keilhacker ist freischaffende Architektin und Urban Design Consultant mit Büro in Berlin. Ihr fachlicher Schwerpunkt gilt dem nachhaltigen Planen und Bauen. Sie ist bei diversen politischen Stadtentwicklungsprozessen hinsichtlich Nachhaltigkeitsstrategien involviert. 2014 wurde sie in die Kommission für nachhaltiges Bauen (KNBau) am Umweltbundesamt berufen. Ein Ziel der KNBau ist es, die wissenschaftliche Diskussion zum nachhaltigen Bauen in die Praxis zu bringen. Seit 2021 ist sie auch Präsidentin der Architektenkammer Berlin und wurde 2022 in den Berliner Klimaschutzrat und das Climate Change Center Berlin Brandenburg berufen.

Jörg Lehnerdt
Leiter Region West, BBE Handelsberatung GmbH
Foto: © BBE
Welche Zukunft haben unsere InnenStädte?
Mit dem „Warenhaus-Sterben“ hat der vermeintliche Niedergang unserer Innenstädte einen neuen, auch von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen Höhepunkt erreicht. Wenn die großen Leitbetriebe der Fußgängerzone nicht überleben, muss es um die deutsche City schlecht bestellt sein.
Worin liegt der Niedergang unserer InnenStädte begründet?
Seit dem „Wirtschaftswunder“ und noch bis in die Nullerjahre hinein wuchs die Kaufkraft der breiten Bevölkerung stetig. „Shopping“ wurde zum Lifestyle, die Kernbereiche unserer Innenstädte wurden zu gut funktionierenden Konsumzonen ausgebaut. Zunehmende Flächennachfrage in den frequenzstärksten Lagen führte zu hohen Mieten und attraktiven Investitionschancen. Handelsimmobilien etablierten sich als eigene Asset-Kategorie, in den Innenstädten meist in Form von Shoppingcentern und großen Geschäftshäusern. Als gefragte Mieter setzten sich vor allem in den Großstädten Filialisten und Franchisesysteme durch. Die damit einhergehende Uniformierung der Fußgängerzonen wurde durchaus kritisiert, der Verlust an Vielfalt und Originalität jedoch als Folge der Kommerzialisierung des öffentlichen Raums hingenommen.
Die Trendwende kam mit dem Boom des Onlinehandels, der dem „stationären“ Einzelhandel immer mehr Marktanteile abnahm: Nahezu jeder zweite Euro wird bei „zentrenrelevanten“ Sortimenten wie insbesondere Mode, Sport und Elektronik inzwischen im Internet ausgegeben. Das führte zu Umsatzrückgang auf den Verkaufsflächen der City, vor allem in den Obergeschossen. Hinzu kamen die Corona-Folgen und zuletzt die Verunsicherung durch Kriege und Inflation. Viele Unternehmen haben dies nicht überlebt.
Welche Bedeutung hat die City für die Städte und Bürger:innen?
Die City ist mehr als eine Konsumzone. Sie ist Boulevard, Projektionsfläche und „Visitenkarte“ einer Stadt. Dorthin zu gehen bedeutet auch Kultur, Gastronomie und Dienstleistungsangebote zu nutzen und andere Menschen zu treffen. Dazu braucht es attraktive öffentliche Räume, herausragende Architektur und die Gewährleistung von Basisfunktionen wie Sicherheit, Sauberkeit, Erreichbarkeit und Orientierung.
Die Menschen, insbesondere auch die jüngeren „Digital Natives“ lieben die City, auch wenn sie ihre Einkäufe zum großen Teil online erledigen. Sie hat sich keineswegs überlebt, ganz im Gegenteil: sie bietet im besten Fall den emotionalen Kristallisationspunkt für die Gesamtstadt (oder sogar Region) und damit einen Kontrast zum nüchternen Einerlei der Vorstädte und der funktionalen Orte des Alltags, etwa Ausbildungs-/ Arbeitsstätten und Verkehrssysteme.
Wie sieht die Stadt von morgen aus?
Die InnenStadt wird mehr sein als die bisherige kommerzielle City. Sie wird nicht nur Marktplatz für Waren sein, sondern auch Bühne für Attraktionen und Raum für Experimente. Sie wird von außen gut erreichbar bleiben müssen, ohne ihren Besucher:innen das Verkehrsmittel vorzugeben. Die Bedeutung des Pkw wird dabei abnehmen, weil Alternativen attraktiver werden.
In der InnenStadt der Zukunft wird Wohnen an Bedeutung gewinnen, ihre Bewohner:innen werden die „15-Minuten-Stadt“ einfordern und umsetzen: Alle benötigten und gewünschten Funktionen müssen zu Fuß erreichbar sein. Zukunftsstädte werden schneller als andere CO2-neutral sein.
Investoren braucht es dabei selbstverständlich auch weiterhin. Sie werden aber verstehen müssen, dass die Rendite ihrer Immobilie zunehmend vom Funktionieren des Gesamtsystems abhängt. Dabei wird es auf Dauer keine „Trittbrettfahrer“ geben, denn die Rechnung geht ohne einen Beitrag zum Gemeinwohl nicht auf.
All das ist keine weltfremde Utopie. Schon jetzt gibt es Städte, deren City davon profitiert, dass der Kurs stimmt. Allen voran touristische Destinationen mit dem Mehrwert einer historischen Altstadt oder besonderer kultureller Highlights. Des weiteren Universitätsstädte mit internationalem Publikum und viel „neuem Denken“. Es fällt auf, dass die experimentierfreudigen Vorreiter meist nicht in Deutschland liegen, sondern etwa in Spanien, Benelux oder Skandinavien.
Jörg Lehnerdt, Dipl.-Kfm., 18 Jahre Erfahrung als Berater bei BBE Handelsberatung GmbH in Köln, zuletzt: Regionalleiter, 9 Jahre Erfahrung als Berater bei Econ-Consult GmbH in Köln, §4 Jahre Erfahrung als Berater bei CIMA Stadtmarketing GmbH in München, Strategie- und Standortberatung für Kommunen, Investoren und Handel
