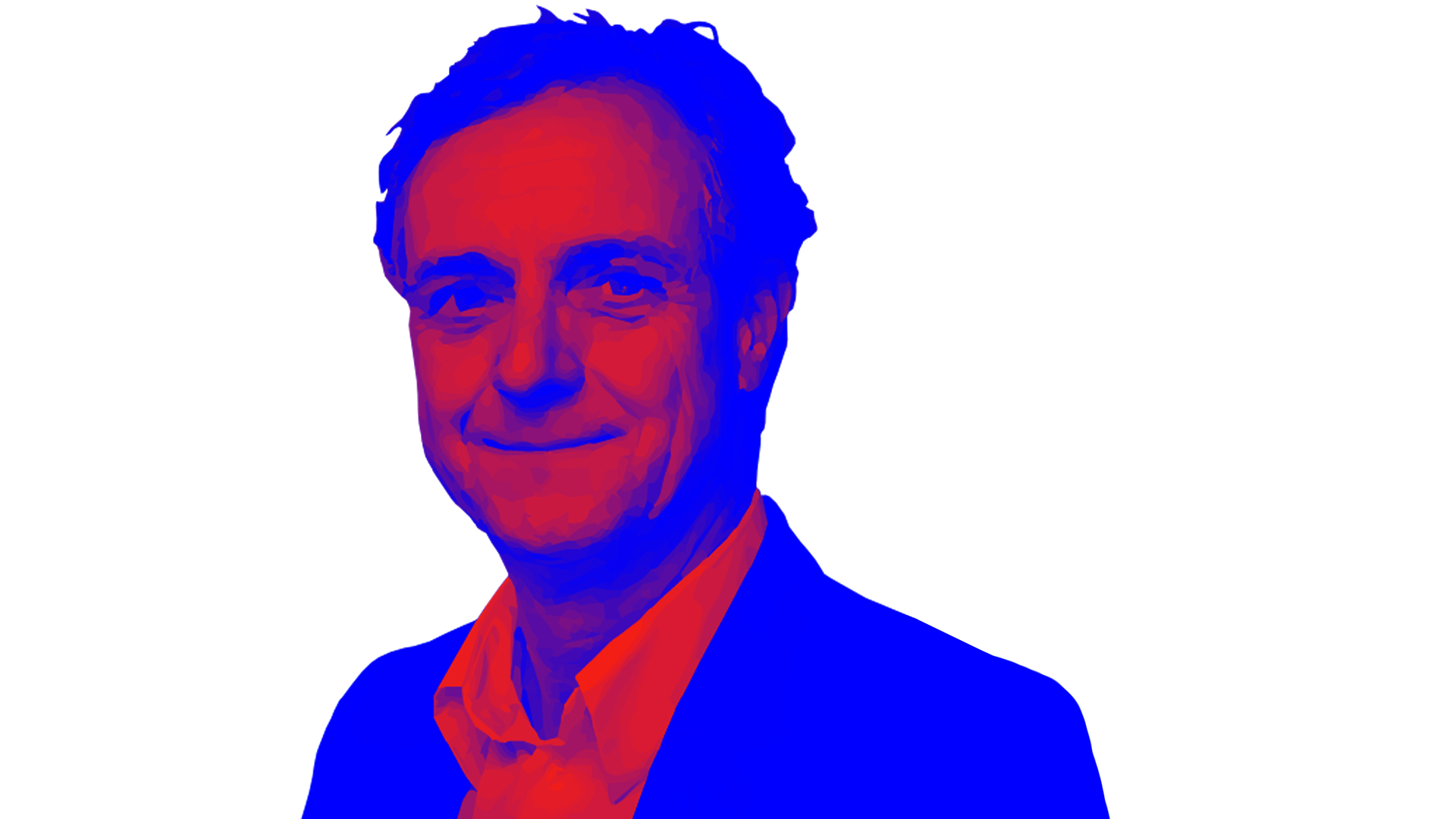
Tucholsky hatte (vielleicht doch) Recht.
Wie wollen wir künftig zusammenleben? Wie Stadt neu denken? Bernd Kniess, Professor an der Hamburger HafenCity University, analysiert das globale Phänomen Stadt.
Das Gespräch fand Anfang April statt.
Wie wird Corona unsere Städte verändern?
Wir können noch gar nicht erfassen, was gerade passiert, mit uns, unserer städtischen Lebenswelt und der Welt insgesamt. Gerade im Hinblick auf die Praktiken von Informationsübermittlung in einer unüberschaubaren Medienlandschaft, scheint mir in der gegebenen Situation zunächst einmal Zurückhaltung geboten. Die Stimme gebührt derzeit vielmehr denjenigen, die mit Ihrem Wissen – und interessanterweise, sogar mit der Offenlegung ihres Noch-Nicht-Wissens – dazu beitragen, die Situation zu beruhigen. Was von unserer Seite getan werden kann, beschränkt sich im Moment darauf, den Hinweisen zu folgen und die gewohnten Abläufe an die sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen.
Was meinen Sie damit?
So einfach die Maßnahmen sind, die an uns herangetragen werden, so schwer scheinen sie manchmal in der Umsetzung zu sein. Die Beschränkungen individueller Freiheit stehen in ständigem Abgleich mit der Bedrohung aller. Gewohnheiten, die bisher selbstverständlich waren, müssen von einem Moment auf den anderen ausgesetzt werden. Was das für die demokratischen Errungenschaften unserer Gesellschaften heißt, vermag ich noch nicht einmal in den Dimensionen zu erfassen, geschweige denn in ihrer Tragweite. Also, lassen Sie uns bitte zunächst die gebotene Ruhe bewahren.
Trotzdem – oder gerade deshalb: Die Veränderungen sind doch schon spürbar: Glasscheiben, Distanzstreifen, Abschirmungen. Die gebaute Umwelt wandelt sich radikal …
Diese Veränderungen sind unmittelbar gebotene Schutzmaßnahmen. Das sind Anpassungen, die spontan getroffen werden, weil gewohnte Sicherheiten von einem auf den anderen Moment nicht mehr gegeben sind. Sie sind temporär und sie werden wieder verschwinden. Was wir hingegen kaum absehen können, ist, wie die physische Distanzierung unsere Praktiken im Umgang miteinander verändern werden. Das kann durchaus positive Effekte haben, wenn wir, beispielsweise durch den Einsatz digitaler Werkzeuge, soziale Nähe aufrecht zu erhalten suchen und alleine dadurch, dass wir uns des Bedürfnisses danach bewusst werden, neue Formen der Solidarität entwickeln, die womöglich nachhaltig wirken.
Es geht also um Grundsätzliches, um unser Zusammenleben. Bleiben wir trotzdem kurz bei den Barrieren, die wieder verschwinden könnten. Von was wird das abhängen?
Wie gesagt, diese Schutzmaßnahmen sind vorübergehend, ihrem Charakter nach sind sie behelfsmäßig und improvisiert. Was uns hingegen weiter beschäftigen wird, ist der Umgang mit der – nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehenden – Ungewissheit, die auch Unsicherheit hervorbringt. Es ist nicht das Virus alleine, das diese Unsicherheit verursacht. Sie entsteht vielmehr aus der Ungewissheit, wie stabil die unterschiedlichen Systeme dem unsichtbaren Angriff standhalten. Was die Krise durch die Störung geregelter Abläufe ja bewirkt, ist, dass die sonst unsichtbar operierenden Strukturen auf einmal offen zu Tage treten. Und um das Gute im Schlechten zu beleuchten, in dieser Sichtbarwerdung kontingenter sozio-materialer Verkettungen wäre ja immerhin die Möglichkeit enthalten, sich überhaupt dazu verhalten zu können und möglicherweise auch den aktiven Umgang mit den immanenten Ungewissheiten zu üben. Was dann die Frage nach sich zöge, wie zum einen die Sichtbarkeit als Grundlage des darauf Einwirkens erhalten oder zukünftig gezielt erzeugt werden kann – und zum anderen, wie dieses Eingreifen in die Gefüge als Gestaltung weiter qualifiziert werden kann.
Und, um noch einmal auf die Barrieren zurückzukommen: Die wirklichen Barrieren sind nicht die gebastelten an der Kasse, sondern die strategischen Mechanismen, die sich durch Nicht-Sichtbarkeit nahezu der Wahrnehmung entziehen, jedoch Eingrenzungs- und Ausgrenzungsmechanismen in einer kaum vorstellbaren Reichweite in Gang setzen. Ganz konkret und von heute auf morgen sind Veränderungen an den Grenzen Europas vorgenommen worden – nicht nur an den sogenannten Außengrenzen, sondern auch nach innen, bis hin zu den kleinmaßstäblichen lokalen Einkapselungen.
In den letzten Jahren war nur von Verdichtung die Rede, von Mini-Apartments, von Sharing und Co-… Living, …-Working und so weiter. Wird Corona das wieder aufheben?
Corona ist nun die akute Bedrohung, die unmittelbar und körperlich erfahrbar wird. Dabei wissen wir um die anderen Krisen und langfristigen Entwicklungen, wie sie etwa aus Vertreibungen durch Krieg und Mangel resultieren oder dem Klimawandel, der unserem Lebenswandel geschuldet, die Lebensgrundlage nachfolgender Generationen bedroht. Mit Ihrer Frage lassen sich zwei unmittelbare Herausforderungen der nahen Zukunft adressieren. Das wäre zum einen, auf quantitativer Betrachtungsebene, die weiter anwachsende Weltbevölkerung, die sich zunehmend in den Städten und städtischen Agglomerationen im Süden dieser Welt konzentriert. Und zum anderen betrifft das, auf qualitativer Ebene, die Frage, wie wir zukünftig in unseren Städten wohnen werden.
Stadt solidarisch neu denken
Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben in den Städten?
Unzweifelhaft ist, dass die Folgen des Klimawandels, mit bereits jetzt auftretenden Starkwetterereignissen, Anpassung, um nicht zu sagen den notwendigen Umbau, unserer Städte nach sich ziehen werden. Immerhin werden laut UN Habitat 90 Prozent der weltgrößten Städte von dem steigenden Meeresspiegel betroffen sein. Dabei geht es nicht nur um Schutzmaßnahmen gegen steigende Pegelstände, wie sie bereits überall getroffen werden, sondern auch um die Schaffung neuer Ausgleichsflächen zur Versickerung überschüssigen Oberflächenwassers – auch in den Städten, was in der Folge wiederum zur Durchlüftung, Abkühlung und Steigerung der Biodiversität beitragen wird und derzeit modellhaft unter dem Begriff der »Sponge-Cities« in China erprobt wird. Absehbar ist auch, dass bei der baulichen Transformation der Stadt die soziale Frage eine vorgeordnete Rolle spielen wird: Wie wir an den Errungenschaften unserer Gesellschaften festhalten können, um endlich eine gerechte Stadt zu erlangen. Wenig hilfreich ist dabei, an überkommenen Dualismen festzuhalten, wie sie etwa in der Gegenüberstellung von Natur und Kultur in unserem Denken immer noch tief verwurzelt ist.
Wollen Sie das bitte erläutern.
Nicht zuletzt die Klimakrise zeigt deutlich, dass es wenig hilfreich ist, die Dinge gegeneinander auszuspielen. Wir können nicht mehr zwischen intentionalem Handeln und den kausalen Prozessen der Natur unterscheiden. Die Zusammenhänge sind komplex miteinander verwoben. Das Interessante ist doch, mit Kontingenz zu operieren, die Dinge in ihrem augenblicklichen Sein, ihrer Wirkungsweise, der historischen Gewordenheit und dem darin begründeten Möglichen zusammenzudenken.
Aber lassen Sie uns beim Wohnen bleiben. Statistische Daten belegen, dass sich das vorherrschende Lebensmodell in den Städten nicht mehr alleine mit dem der Kernfamilie beschreiben lässt. Die überwiegende Anzahl der städtischen Bevölkerung wohnt derzeit alleine oder zu zweit.¹ Daraus ließe sich unmittelbar ableiten, das bestehende Wohnungsangebot etwa um Mikroformen des Wohnens zu erweitern. Das alleine allerdings, erscheint mir zu kurzfristig gedacht.
Wenn Sie also an das Wohnen in der Zukunft denken, dann …
… etwa daran, wie die Wohnung nicht nur unseren gegenwärtig praktizierten Lebensweisen entsprechend angeeignet wird, sondern weitergehend, deren zukünftige Entwicklung ermöglicht und begünstigt. Das hat zur Folge, dass wir uns über die Wohnung selbst Gedanken machen müssen und nicht einfach nur gängige Modelle reproduzieren. Dabei gilt es auch die demographische Entwicklung einer überalternden Gesellschaft mitzudenken. Es ist sicher lohnend, bei der Analyse des weiter ungebrochen wachsenden Wohnflächenverbrauchs² eines jeden, nicht nur bestehende Wohnungstypologien mit Haushaltsgrößen quantitativ abzugleichen, sondern auch unsere Praktiken des Wohnens mit zu betrachten. Also beispielsweise, dass sich diese nicht alleine auf die Wohnung beschränken, sondern auch in die Stadt ausgelagert haben.
Darum geht es bei vielen aktuellen Planungen aber noch gar nicht. Eher geht es um Masse in kurzer Zeit
… Richtig. Die zunehmend in Bündnissen zwischen Politik und Wohnungswirtschaft verfolgten Lösungsansätze fokussieren vorrangig quantitative Ziele. Im Widerspruch, wie er sich aus der Gegenüberstellung von Haushalten und Wohnungsbeständen bereits ablesen lässt, steht der immer noch große Anteil von Drei- und Vierzimmerwohnungen. Diese machen beispielsweise in Hamburg immer noch die Hälfte der Neubauten aus. Erweitert wird das Angebot zwar zunehmend mit bereits angesprochenen Mikro-Formen des Wohnens, die sich schwerpunktmäßig an alleinwohnende Studierende richten. Zunehmend ausgestattet mit Service-Angeboten adressieren diese besserverdienende StadtbewohnerInnen, die sich zudem oft multilokal eingerichtet haben. Wenn es um die Qualität zukünftigen Wohnens ginge, wäre für mich nicht alleine Lage, Größe oder Ausstattung maßgeblich, sondern insbesondere die Frage nach einer neuen Sozialität im Wohnen – nach der Kernfamilie. Hier wären dann die von Ihnen genannten gemeinschaftlichen Wohnformen das Thema, das im Augenblick jedoch noch eher die Ausnahme darstellt.
Was folgern Sie daraus?
Interessant wird es dann, wenn wir – auch unter dem Aspekt der Leistbarkeit – die beiden Charakteristika Mikro- und Co- zusammen denken, etwa in der Gestaltung eines reduzierten persönlichen Rückzugsbereichs in Verbindung mit gemeinschaftlich geteilten Lebensbereichen und eingebettet in eine erweitert zu denkende städtische Infrastrukturlandschaft. Ein Verständnis von Wohnen also, das sich in die Stadt erweitert und nicht von ihr geschützt (gated) abgrenzt. Wenn wir nun also die Anforderungen klimabedingter Transformation der Stadt mit in unsere Überlegungen zum Wohnen mit einbeziehen, geht es also immer weniger um die Aufrechterhaltung binärer Gegensätze, wie sie etwa Tucholsky in seinem ›Ideal‹ als unerreichbar gegenüberstellte. Viel spannender wird es doch sein, die Bandbreite zwischen den Extremen auf ihre Potenzialitäten hin neu auszuleuchten.
Sie meinen Tucholskys Gedicht von 1927: Ja, das möchste / Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, / vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; / mit schöner Aussicht, ländlich-mondän, (…)
Nun, das ist natürlich das Spiel mit den Sehnsüchten nach dem jeweils anderen, Nicht-Verfügbaren. Aber die Verlockung an der Idee ist doch, dass die Stadt das gesamte Spektrum bereithält.
Stadt als weltweites Phänomen
In Europa haben wir zwar Großstädte, aber keine »Megalopolis«. Was ändert sich weltweit gerade bei unserem Bild von Stadt?
Das Bild, verstanden als Repräsentation von Wirklichkeit (oder in der Architektur als Vorwegnahme von möglicher Zukunft) ist nie Wirklichkeit, sondern eine Vorstellung von Wirklichkeit. Und die entsteht aus der Überlagerung eigener Wahrnehmungen, in Erinnerung der unmittelbaren Begegnung und Nutzung, genauso wie aus Bildern, Filmen, Romanen, ja möglicherweise sogar Musik und mitunter sogar der Speisen die wir mit bestimmten Orten und Städten genossen haben und mit ihnen in Verbindung bringen.
Also kämpfen wir mit unseren eigenen Vorstellungen von Stadt …
Rolf Lindner³ hat es das »Imaginäre der Stadt« genannt, das sich der Vorstellung des Städtischen als kulturell resonantem Vorstellungsraum in gleichem Maße widmet, wie dem physischen Ort für den Alltag ihrer BewohnerInnen. Was Lindner damit in Erinnerung ruft, ist die Alltäglichkeit von Stadt, an deren Sich-ereignen-Könnens wir beteiligt sind, mit unseren Handlungen, unserem Wissen und den Weisen, wie wir dieses Wissen hervorbringen und all das zusammengenommen, in unserem ›Bild der Stadt‹ zum resonieren und in Austausch bringen. Wichtig scheint mir hervorzuheben, dass es dabei nicht um das »Abbild« einer vorausgesetzten (materiellen) »Wirklichkeit« geht, sondern die je eigene Vorstellung der Stadt die Voraussetzung für die Greifbarkeit des Bildes ist.
Wollen Sie ein Beispiel geben?
Kevin Lynch⁴ hat mit seinen fünf Elementen ja nicht alleine das »Bild der Stadt« aus gegenständlichen Formen zusammengesetzt zu beschreiben versucht, sondern aus deren Wahrnehmung im städtischen Zusammenhang, wie auch Christopher Alexander⁵ seinen »Patterns« die Handlungen der NutzerInnen zugrunde legt, um daraus eine neue (Entwurfs-)Sprache zu entwickeln. Oder nehmen wir Venturi, Scott Brown, Izenour⁶, die sich, gemeinsam mit ihren Studierenden, der architektonischen und städtebaulichen Grundlagen der von kommerzialisierter Bilderflut überformten Stadt zu vergewissern suchen und dabei neue Methoden der Datenerhebung und kartographischen Auswertung entwickeln; Koolhaas, der seit »Delirious New York«⁷ den Programmen der Stadt nachspürt oder Atelier Bow Wow, die auf den Spuren von Wajuro Kons⁸ urbaner Ethnography die Methode in die »Architectural Ethnography« weiterentwickeln und einer städtischen »Behaviorology«⁹ und »Commonalities«¹⁰ auf den Grund zu kommen suchen. Bei all den Versuchen geht es um das relationale Verhältnis von materieller Umwelt und ihrem Gebrauch durch ihre Akteure an den spezifischen Orten.
Relationaler Raum?
Der Begriff des ›relationalen Raums‹ hat unser Verständnis des Behälterraums endlich um die handelnden Akteure erweitert, und nicht erst mit der Akteur-Netzwerk-Theorie¹¹ können wir verstehen, dass unsere Gebäude, respektive unsere Stadt, nicht alleine aus einer baulich-physischen Struktur besteht, zudem wie Handlungswirksamkeit (Agency) im Zusammenwirken von menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren entsteht. Christopher Dell schließlich entwickelt daraus seinen Ansatz einer Improvisation des Raums. ¹²
Lucius Burckhardt sprach davon, dass Design unsichtbar sei, gilt das also auch für die Stadt – oder besser dem jeweiligen Bild von Stadt?
Burckhardts Plädoyer, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist ja nicht eines für die Unsichtbarkeit von Design an sich, sondern für das Mitdenken und Einbeziehen der unsichtbaren Teile des Systems in die Gestaltung – was auch mein Plädoyer ist: Die Akteure und ihre Handlungen mitzudenken, respektive die Kategorie der Funktion um die des Gebrauchs zu erweitern. Was ich mit den Überlegungen zu untermauern suche, ist die These, dass es nicht mehr alleine um »das Bild« oder »die Form« – verstanden als ästhetische Einheit – geht, ebenso wenig, wie wir weiterhin von »einer Wirklichkeit« oder von »unumstößlichen Fakten« ausgehen. Wir wissen um deren Produziertheit. Die Konsequenz solchen Denkens ist allerdings, dass wir Stellung beziehen müssen, was unsere »Dinge von Belang« (matters of concern)¹³ sind, nach denen wir die Dinge neu versammeln.
Lehren für Stadtplaner
Versuchen wir den Rücksturz ins Alltägliche. Denn gerade kommt alles zusammen: Klimawandel, Ressourcenmangel, Migration. Wie sollten Stadtplaner auf einen solch dynamischen Wandel reagieren? Und was können wir aus Asien lernen oder aus Südamerika?
Genau darum geht es, das Alltägliche lesen zu lernen, in seinen Wirkungsgefügen offenzulegen, diese zu teilen, zur Verhandlung zu bringen und die beteiligten Akteure zu ermächtigen, gestaltend darauf einzuwirken. Dabei geht es nicht nur um gebauten Raum, sondern auch um die Offenlegung der Bedingungen, wie er hervorgebracht wird und, als Produziertes, auch auf die handelnden Akteure zurückwirkt. Der Blick auf andere städtische Kontexte ist dabei so herausforderungsvoll wie lohnend, weil der Grad von Komplexität, Ambiguität und Widersprüchlichkeit in den Dynamiken von Wachstum und Entwicklung in den Megalopolen dieser Welt offener zu Tage tritt, als in den (scheinbar) wohlgeordneten Strukturen europäischer Städte. Was wir dort lernen können, ist wie das kontingente Zusammenwirken von Bestehendem und Möglichem in die Entwicklung mit einbezogen werden kann.
Viele Metropolen sind auf das Auto ausgerichtet und ohne es gar nicht mehr denkbar. Lässt sich diese Fixierung noch zurückdrehen? Wie sieht beispielsweise L. A. in 20 Jahren aus?
Wir müssen feststellen, dass sich das Leitbild der autogerechten Stadt mit seiner funktionalistisch ausgerichteten Planung wohl strukturell mit am nachhaltigsten in unsere Städte eingeschrieben hat. Ungebrochen als Symbol einer auf Wohlstand und Luxus ausgerichteten Lebensweise, scheint das individuelle Mobilitätsversprechen als Ausdruck individueller Freiheit bis heute nahezu ungebrochen. Dass wir mit unserer Lebensweise die Grenzen des Wachstums überschritten haben, ist nicht neu, wir wissen um die Ursachen der Krisen – auch um ihre Wirkungen und Reichweiten. Neu an der aktuellen Situation ist die Erfahrung, wie körperlich nah eine Krise an uns heranreicht, wie umfassend und radikal die Maßnahmen sind, uns davor zu schützen. Und, dass sie ergriffen werden können zeigt doch das Spektrum möglichen Handelns auf. Das sollte und zu denken geben.
Sind Fragen der Schönheit nun obsolet angesichts steigender Probleme? Lassen sich Massenbehausungen auch gut gestalten?
Ich denke, es geht heute sowenig um eine akademische Debatte zu Fragen der ›Schönheit‹, wie ›Massenbehausungen‹ ein Thema beim Um- und Weiterbau der Städte sein kann. Beide Begriffe sind konnotativ belastet und wenig hilfreich, sich vorbehaltlos dem eigentlichen Gegenstand ›Stadt‹ in seiner eigentlichen Entwicklungsfähigkeit und -möglichkeit zu widmen.
Was hoffen Sie für die Zukunft? Das Thema Solidarität muss nun mit Leben gefüllt werden, oder?
Die Bedeutung des Begriffs Solidarität erlangt gerade eine ungeahnte Erweiterung, insofern er nicht alleine auf einem Reflex auf Ausgrenzung einer bestimmten Klasse oder Gruppe rekurriert, sondern in einem Moment kollektiver Verwundbarkeit neue Formen von Sorge und Verantwortung hervorbringt – so oft beschrieben mit dem offensichtlichen Widerspruch einer »Nähe durch Distanz« und vorsichtig geübt in den Handlungen der letzten Tage, mit denen neue Formen einer solidarischen Stadtgesellschaft erprobt werden.
Das klingt gar nicht pessimistisch!
Nein, die Zeit steht nicht still. Der verordnete Raum des Wartens wird produktiv gewesen sein. Sich seiner selbst zu vergewissern und im Tun mit Anderen neue Möglichkeiten der nächsten Gegenwart zu erschließen, das wird keine verlorene Zeit gewesen sein.
¹ Bspw.: https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Faltblätter/Faltblatt_Mikrozensus_2017.pdf
³ Rolf Lindner, Die Entdeckung der Stadtkultur (1990) 2007
⁴ Lynch, Kevin, The Image of the City, Cambridge, 1960
⁵ Alexander, Chr., Ishikawa, S., Silberstein, M., A Pattern Language, Oxford, 1977
⁶ Venturi, R., Scott Brown, D., Izenour, S., Learning from Las Vegas, Cambridge, 1972
⁷ Koolhaas, Rem. Delirious New York, Cambridge, 1978
⁸ Kon, Wajiro, Yoshida Kenkichi, Kōgengaku saishū: Moderunorojio (Modernologio Collection), Tokyo, 1931
⁹ Atelier Bow-Wow, Behaviorology, New York, 2010
¹⁰ Atelier Bow-Wow, Commonalities: Production of Behaviors, Tokyo, 2014
¹¹ Als maßgebliche Vertreter wären bspw. Michel Callon, Bruno Latour und John Law zu nennen
¹² Dell, Christopher, The improvisation of space, Berlin 2019
¹³ Latour, Bruno, Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern 2003 In Critical Inquiry – Special issue on the Future of Critique. Vol 30 n°2 pp.25-248, Winter 2004. http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/89-CRITICAL-INQUIRY-GB.pdf
